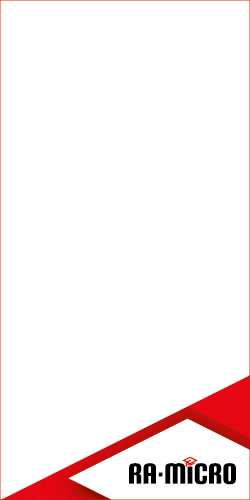Vier Frauen in der Einöde
Recht cineastisch, Teil 47: „In die Sonne schauen“ von Mascha Schilinski
Thomas Claer
 Wird in Sachsen-Anhalt tatsächlich Plattdeutsch gesprochen?! Ja, aber nur in der Altmark, dem nördlichsten Zipfel des aktuell zweitärmsten deutschen Bundeslandes, eingeklemmt zwischen Niedersachsen, Mecklenburg und der nordbrandenburgischen Prignitz, wo überall auch heute noch Varianten der niederdeutschen Mundart gepflegt werden, zumindest von ein paar älteren Bewohnern auf dem Lande. Vor 120 Jahren setzt die Handlung ein, sofern man von einer solchen überhaupt sprechen kann, im preisgekrönten poetisch-historischen Experimentaldrama „In die Sonne schauen“ der 1984 in West-Berlin geborenen Filmemacherin Mascha Schilinski. Und zunächst sprechen alle auf dem altmärkischen Bauernhof, der über vier Generationen hinweg den Hintergrund des Geschehens darstellt, noch Platt, freundlicherweise fürs Publikum mit hochdeutschen Untertiteln versehen. Das ändert sich erst in der Nachkriegszeit, als mehr und mehr der Berlinische Tonfall auch in die entlegenen Gebiete nördlich der Spreemetropole einzieht. Um 1905 hieß es auf dem Bauernhof aber noch: „Treck di an, hab ick jesacht.“
Wird in Sachsen-Anhalt tatsächlich Plattdeutsch gesprochen?! Ja, aber nur in der Altmark, dem nördlichsten Zipfel des aktuell zweitärmsten deutschen Bundeslandes, eingeklemmt zwischen Niedersachsen, Mecklenburg und der nordbrandenburgischen Prignitz, wo überall auch heute noch Varianten der niederdeutschen Mundart gepflegt werden, zumindest von ein paar älteren Bewohnern auf dem Lande. Vor 120 Jahren setzt die Handlung ein, sofern man von einer solchen überhaupt sprechen kann, im preisgekrönten poetisch-historischen Experimentaldrama „In die Sonne schauen“ der 1984 in West-Berlin geborenen Filmemacherin Mascha Schilinski. Und zunächst sprechen alle auf dem altmärkischen Bauernhof, der über vier Generationen hinweg den Hintergrund des Geschehens darstellt, noch Platt, freundlicherweise fürs Publikum mit hochdeutschen Untertiteln versehen. Das ändert sich erst in der Nachkriegszeit, als mehr und mehr der Berlinische Tonfall auch in die entlegenen Gebiete nördlich der Spreemetropole einzieht. Um 1905 hieß es auf dem Bauernhof aber noch: „Treck di an, hab ick jesacht.“
„In die Sonne schauen“ ist überwältigend in seinen Bildern, den eingefangenen und erzeugten Stimmungen, durch seine stets düster und bedrohlich wirkende Hintergrundmusik, erzählt dabei aber keine Geschichte im konventionellen Sinne. Die einzelnen Episoden sind nur recht lose miteinander verbunden. Vieles wird lediglich angedeutet, bleibt im Dunkeln. Auf Wikipedia lässt sich nachlesen, was einem beim Anschauen im Kino alles entgangen ist. Auch die verwandtschaftliche Beziehung der vier weiblichen Protagonistinnen in jeweils einer der vier gezeigten Epochen (Kaiserreich, 2. Weltkrieg, Achtzigerjahre-DDR und kurz vor der Gegenwart) zueinander erschließt sich keineswegs auf Anhieb. Der Film springt im bewährten 37-Grad-Stil fortwährend zwischen den Zeitabschnitten hin und her. Als roter Faden über die Jahrzehnte hinweg dient die Darstellung des hier insbesondere weiblichen sexuellen Begehrens, wobei auch immer wieder inzestiöse Verstrickungen anklingen, was aber in solch einer dünn besiedelten Region, zumal bei der damals noch stark eingeschränkten Mobilität, gut nachvollziehbar erscheint.
Die längste Zeit, das macht dieser Film deutlich, haben die Menschen ganz überwiegend unter elementaren Zwängen gelebt, die ihnen kaum persönliche Freiheiten ließen. Erst in der Gegenwart, als neuromantische Ankömmlinge aus Berlin den alten Hof für sich entdecken, ist die schwerwiegendste Frage für junge Mädchen, ob es Vanille- oder Erdbeereis sein soll. Doch dann zieht plötzlich auch hier wieder existentieller Ernst ein, denn Krankheit und Tod haben bis heute noch alle technischen und kulturellen Fortschritte überdauert. Kurzum, wer bereit ist, sich auf einen Kunstfilm mit betörend suggestiven Bildern einzulassen und nicht auf einer herkömmlichen „Erzählung“ insistiert, wird „In die Sonne schauen“ goutieren.
In die Sonne schauen
Deutschland 2025
Regie: Mascha Schilinski
Drehbuch: Mascha Schilinski, Louise Peter
Länge: 149 Minuten
Darsteller: Hanna Heckt, Lea Drinda, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler