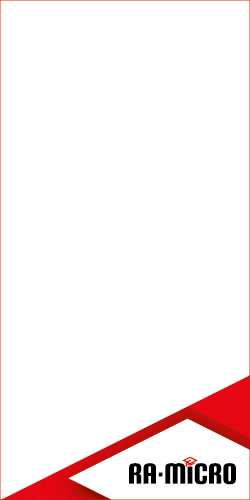„Einlösung des Rechtsanspruchs auf eine inklusive Schule“
Fragen an Dieter Zielinski, den Vorsitzenden der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule (GGG)
Benedikt Vallendar

Dieter Zielinski (Foto: privat)
1. Warum ist aus Ihrer Sicht die Integrierte Gesamtschule die „bessere“ Schulform?
Die Schulen des gemeinsamen Lernens1 sind „Schulen für alle!“ Es wird nicht sozial sortiert. Nur in diesen Schulen kann Demokratie sinnvoll erlebt und gelernt werden kann. Die Schulen leisten einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Nur sie lösen den Rechtsanspruch auf eine inklusive Schule ein. In den Schulen des selektierenden Schulsystems lernen in der Regel junge Menschen gleicher sozialer Herkunft und demzufolge vor allem in ihrer gesellschaftlichen Blase. Absolventen von Gymnasien kennen zumindest aus ihrem schulischen Umfeld keine oder nur sehr wenige Menschen mit Beeinträchtigungen. Dasselbe gilt, wenn es um die Interessen von Gleichaltrigen geht, die in Armut leben müssen.
Internationale Vergleichsstudien zeigen, dass Schulsysteme, die nicht segregieren, zu den erfolgreichsten gehören. Zudem ist die Bildungsgerechtigkeit in diesen Systemen größer. In einem Spiegelinterview (Ausgabe 2025/1) bezeichnete John Hattie das deutsche Schulsystem als das ungerechteste, das er kenne. In keinem Land ist die herkunftsbedingte Bildungsungerechtigkeit größer als in Deutschland.
2. Wie ordnen Sie die allseits bekannten Argumente der Gesamtschulgegner, u.a. des Deutschen Philologenverbandes ein?
Den Gesamtschulbefürwortern wird häufig vorgeworfen, ideologisch zu sein. Doch genau das Gegenteil trifft zu. Die Verfechter des selektiven Schulsystems argumentieren u.a. mit der Vorstellung eines statischen Begabungsbegriffs. Der Stand der Wissenschaft ist derzeit überwiegend der, dass im Alter von 10 Jahren nicht zu vorherzusagen ist, wie sich die kognitiven und anderen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern im Verlauf der weiteren Schulzeit entwickeln werden. Grundschulgutachten erweisen sich häufig im Nachhinein als nicht zutreffend. Vielen Schülerinnen und Schülern an Gesamtschulen gelingt es zudem, höhere Abschlüsse als ursprünglich prognostiziert zu erreichen. Im gegliederten System wären sie unter ihren Möglichkeiten geblieben.
3. CDU und AfD, die das gegliederte Schulwesen favorisieren, kommen in Ostdeutschland derzeit zusammen auf hohe Zustimmungswerte. Frage: Wie gehen Sie damit um, dass offenkundig eine Mehrheit der Bevölkerung, v.a. in Ostdeutschland und ggw. auch in Rheinland-Pfalz, wo die AfD derzeit auf 23 % kommt, Erhalt und weitere Profilierung des Gymnasiums wünscht?
Die Vorstellung der GGG von einer demokratiestiftenden Schule, in der Teilhabe praktiziert und Vielfalt als Chance gesehen wird, entspricht nicht dem Menschenbild der AfD. Es ist ein erklärtes Ziel der AfD, unsere Gesellschaft zu einem homogenen völkischen Staat, in dem die darin lebenden Menschen allein die deutsche Kultur teilen, umzuformen. Die zumindest in Teilen erwiesenermaßen rechtsextreme Partei kann mit ihren schulpolitischen Vorstellungen keine Orientierung für uns sein.
CDU und AfD sind die beiden Parteien in Deutschland, die nicht bereit sind, an der sozialen Spaltung der Schülerschaft etwas zu verändern. Nach unserer Auffassung kommt es gerade in Zeiten der Demokratiegefährdung und zunehmender Fragmentierung der Gesellschaft darauf an, den Gedanken der Vielfalt und des gemeinsamen Lernens zu stärken. Dafür wollen wir mit der erfolgreichen Arbeit unserer Schulen überzeugen und eine gesellschaftliche Zustimmung erreichen.
Vielen Menschen, die im „alten“ Schulsystem groß geworden sind, haben den Vorgang des Sortierens und Zuschreibens erlebt und können sich eine die Vielfalt bejahende Schule schlicht nicht vorstellen. Es gibt viele, gute Beispiele in Deutschland; die zeigen, dass es anders geht. Auch hierfür schaffen wir Öffentlichkeit.
4. In Berlin, wo traditionell linke Parteien auf hohe Zustimmungswerte kommen, gibt es ggw. 30 grundständige Gymnasien ab Klasse 5, neben vielen anderen ab Klasse 7.
Frage: Wie ordnen Sie deren politisch (auch bei der SPD) nicht in Frage stehende Existenz ein?
Das ist eine bildungspolitische Katastrophe. Diese Klassen sind fast oder ganz eine Folge der Wiedervereinigung. Altbeamte der Westbundesländer bekamen nicht nur eine „Buschzulage“, sondern auch garantierte Schulplätze an Gymnasien ab Klasse 5 garantiert. Deshalb wurden diese Klassen eingeführt. Die Folgen dieser Politik sind die Schwächung der Grundschulen durch Entfernung der Leistungsspitzen und die Verschärfung der bildungspolitischen Probleme in der Stadt Berlin, d.h. die Verschwendung von Ressourcen, die so sehr benötigt würden. Jedes Berliner Kind in Klasse 4 hat an einer Berliner Grundschule einen Schulplatz. Jeder Schüler, der die Grundschule Anfang 5 verlässt braucht einen neuen Raum und neue Lehrer, die anders eingesetzt werden könnten blieben die Jungen und Mädchen in ihrer Grundschulklasse. Es sind derzeit mindestens 19 solcher Klassen. 19 Räume, die anders verwendet werden könnten, mindestens 19 Klassenlehrer*innen, die anders arbeiten könnten. Berlin hat derzeit die größten Probleme seiner Geschichte nach 1949 was die Versorgung mit originär ausgebildeten Lehrkräften und Unterrichtsräumen betrifft.
5. Der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers (EWTH Zürich) sagte wiederholt, dass die integrierte Gesamtschule analog zur sogenannten „Reformpädagogik“ v.a. von ihrem rhetorischen Glanz lebe. Frage: Wie ordnen Sie diese Haltung Herrn Oelkers ein?
Jürgen Oelkers hat diese Aussage vor dem Hintergrund seiner Interpretation der damaligen Schulwirklichkeit 1990 geäußert. Dass er diese Aussage auch heute noch auf die Schulen des gemeinsamen Lernens bezieht, ist nicht bekannt. Mit Sicherheit hat sie heute keine Gültigkeit. Die erfolgreiche Arbeit der Schulen des gemeinsamen Lernens ist vielfach durch nationale und internationale wissenschaftliche Studien belegt. Zusätzliches Zeugnis sind die vielen Auszeichnungen bei der Vergabe von Schulpreisen, wie z.B. dem deutschen Schulpreis, bei dem auch gute Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu den Vergabekriterien gehören.
6. Bundesweit steigt die Zahl der Privatschulen. Zudem gibt es im lange rot-grün regierten Sachsen-Anhalt und Sachsen neben Gesamt- und Gemeinschaftsschulen auch Gymnasien mit erhöhtem Leistungsprofil für Hochbegabte. Frage a: Wie bewerten Sie diese widersprüchliche Schulpolitik? Frage b: Wie positionieren Sie sich zur These, dass infolge der vielen Privatschulen aus dem dreigliedrigen Schulsystem durch Elternwille längst ein viergliedriges geworden ist?
Die GGG tritt für ein starkes und Eltern überzeugendes öffentliches Schulwesen ein. Nur damit kann einer Spaltung der Gesellschaft entgegengewirkt werden. Nur ein solches System ist demokratiestiftend und inklusiv.
Der Besuch von Privatschulen erfolgt sozial selektiv. Es sind vor allem Eltern aus einem eher privilegierten sozialen Milieu, die sich für eine Privatschule entscheiden. Folglich haben Schüler:innen auf Privatschulen überproportional häufig Eltern mit höherem Bildungsgrad, höherem sozioökonomischen Status und seltener eine Zuwanderungsgeschichte. Nach Artikel 7 GG ist die Genehmigung einer Privatschule nur dann zu erteilen, wenn durch diese eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Das ist oft nicht der Fall und verstößt eindeutig gegen das Grundgesetz und muss beseitigt werden. Dazu fehlt es der Bildungsadministration am Durchsetzungswillen.
7. Was spricht aus Ihrer Sicht gegen die These, dass unterschiedliche Begabungsprofile eben auch ein differenziertes Schulsystem benötigen?
Eingedenk der Tatsache, dass diesem Umstand im Ausland zumeist durch teure Privatschulen Rechnung getragen wird (USA, Brasilien, England, Chile etc.).
Zur falschen Annahme eines statischen Begabungsbegriffs haben wir uns schon unter 2. geäußert. Wir bezweifeln auch, dass mit dieser Annahme die Motive beschrieben sind, die Eltern dazu motivieren, ihre Kinder an Privatschulen anzumelden. Hier dürften Statusfragen und die Wahrung von Privilegien eine entscheidende Rolle spielen.
8. Mit welchen Argumenten würden Sie einen Schüler, der die Aufnahmeprüfung für die Gymnasien Schulpforta in Sachsen-Anhalt und Sankt Afra (in Meißen) bestanden hat, zum Besuch einer integrierten Gesamtschule oder Gemeinschaftsschule zu überzeugen versuchen?
Dazu meine persönliche Antwort: Beide genannten Schulen sind Internatsschulen mit einer jahrhundertealten Tradition und dem Kennzeichen der Förderung von Hochbegabung als Grundlage für ihre Auswahl von Schülerinnen und Schülern. Der Wechsel an diese Schulen ist frühestens zum 7. Schuljahr (Sankt Afra) bzw. zum 9. Schuljahr (Schulpforta) möglich. Ob das unter 6. angesprochene Sonderungsverbot eingehalten wird, kann ich nicht beurteilen.
Grundsätzlich hätte ich Interesse daran, mit dem Schüler ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, um mehr über dessen Motive und Entscheidungshintergründe für den Schulwechsel zu erfahren. Ich würde darauf hoffen, dass dieser Schüler auch die Bereitschaft aufbrächte, sich anzuhören, warum ich die Integrierte Gesamtschule/Gemeinschaftsschule für eine einer demokratischen Gesellschaft angemessene Schule halte. Übrigens finden sich auch an Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Schülerinnen und Schüler mit herausragenden kognitiven Leistungen, die dort gefördert werden und nach ihrer Schulzeit z.B. von der Studienstiftung des deutschen Volkes ausgewählt werden, und die zusätzlich die Vielfalt der Mitschüler und Mitschülerinnen sehr schätzen. Vielleicht könnte ich ihn von der Bedeutung der Schulform Gesamtschule/Gemeinschaftsschule überzeugen.
Ob der Schüler daraufhin seine Entscheidung revidierte, steht auf einem anderen Blatt.
9. Gesamtschulbefürworter setzen sich tendenziell immer gern für mehr „Diversität“ in unserer Gesellschaft ein, wollen aber eine Einheitsschule für alle.
Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?
Wir setzen uns für „Die eine Schule für alle ein“ und meinen damit ein inklusives Schulsystem, in dem die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler repräsentativ für die Gesellschaft ist, in der sie leben.
Leider wird der Begriff der Einheitsschule von den Gegnern unserer Schulform immer wieder ideologisch verbrämt benutzt. Die darin verborgene Botschaft und Unterstellung ist diejenige der Gleichmacherei. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die „Eine Schule für alle“ bekennt sich zur Vielfalt. Mittlerweile basiert das Lernen in diesen Schulen auf einer Pädagogik, in der individuelles und gemeinsames Lernen zu einer erfolgreichen Synthese gebracht worden sind. Wir können hier nur noch einmal auf die vielen Schulpreisschulen verweisen, die häufig für die erfolgreiche Umsetzung dieser Pädagogik ausgezeichnet wurden.
Gleichmacherei geschieht eher in den Schulen des gegliederten Schulsystems, wo vor der Annahme einer vermeintlichen Homogenität alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam, zur selben Zeit, am selben Ort, im selben Tempo, denselben Unterrichtsstoff, mit denselben Ergebnissen unterrichtet bekommen. Eine solche Pädagogik ist weder zukunftsorientiert noch erfolgreich und vor dem Hintergrund der hohen Sitzenbleiber Quote ökonomisch fatal.
Herr Zielinski, wir danken für das Gespräch.
Dieter Zielinski ist Vorsitzender GGG, StDir im Ruhestand, Fächer: Mathematik, Biologie, Informatik, zuletzt stellv. Schulleiter einer Gemeinschaftsschule in Kiel, u.a. auch Lehrkräftefortbildner und Curriculumentwickler.