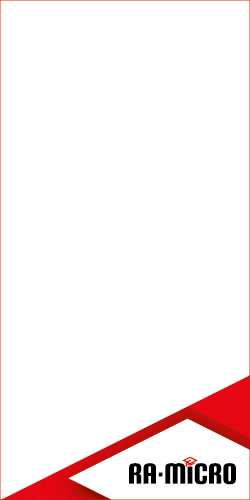Der Traum von der fairen Datenallmende
Data Act rechtzeitig kommentiert
Matthias Wiemers
 Seit langem besteht die Vorstellung, aus der Überfülle von Daten, die in zunehmender Frequenz gewonnen werden, könnte man einen hohen Nutzen durch einen europäischen Datenbinnenmarkt schaffen. Dass dies nur im Rahmen notwendiger Grenzen geschehen kann, ist dabei klar, und diese Grenzen bestehen nicht nur im Datenschutzrecht (vgl. hierzu die Einleitung, Rdnr. 1).
Seit langem besteht die Vorstellung, aus der Überfülle von Daten, die in zunehmender Frequenz gewonnen werden, könnte man einen hohen Nutzen durch einen europäischen Datenbinnenmarkt schaffen. Dass dies nur im Rahmen notwendiger Grenzen geschehen kann, ist dabei klar, und diese Grenzen bestehen nicht nur im Datenschutzrecht (vgl. hierzu die Einleitung, Rdnr. 1).
Nun haben ausgerechnet drei Professoren der Universität Potsdam, die bekanntlich aus einer Pädagogischen Hochschule und – was die Rechtswissenschaftliche Fakultät angeht –, aus der ehemaligen und 1990 kurz umbenannten „Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft“ der DDR hervorgegangen ist, sich der Kommentierung einer EU-Verordnung gewidmet, die wiederum als „Act“ bezeichnet wird und seit dem 12. September weithin gilt.
Die drei Herausgeber werden von weiteren 16 Autorinnen und Autoren unterstützt, die vornehmlich der anwaltlichen Praxis entstammen.
Mitherausgeber Björn Steinrötter beschreibt in seiner Einleitung zunächst Konturen des Datenwirtschaftsrechts und bettet den hier kommentierten so genannten EU-Data-Act (EU) 2023/2854 hierin ein. Dabei erblickt Steinrötter das „übergreifende Ziel“ des Datenwirtschaftsrechts darin, „neue Technologien mit ausreichend Daten zu versorgen“ (Rdnr. 3). Nach der Darstellung der Schwerpunkte des neuen Rechtsakts werden noch durch nationales Recht zu schließende Lücken und sodann das Verhältnis des Acts zu anderen Rechtsgebieten und Rechtsakten dargestellt. Etwas ungewöhnlich ist es, dass der Kommentar die Erwägungsgründe der Verordnung als Anhang enthält. Gleichwohl gehen die Einzelkommentierungen natürlich auf die Erwägungsgründe ein; sie implementieren sie nur nicht in den Einzelkommentierungen. Diese Einzelkommentierungen erfolgen nicht nach einem einheitlichen Schema. Auffällig ist, dass die Kommentierungen oft umfassend auf die Entstehungsgeschichte einer Regelung sowie auf ihre Auslegung eingehen – zumindest auf den Normzweck, aber oft auch darüber hinaus. Steinrötter stellt eingangs bereits klar, dass – entgegen einer Annahme in der Literatur – der Act keine echte „Datennutz-Grundverordnung“ sei (Rdnr. 6). Wie schade um das schöne Bonmot! Auch arbeitet Steinrötter heraus, dass es sich um eine Mischung aus öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Normen handelt (vgl. Rdnr. 9 a. E.). Einmal mehr wird damit die überkommene Unterscheidung fragwürdig, denn es ist ja gerade die digitale Datenwelt, die keine natürlichen Grenzen zu kennen scheint und die nur beherrschen kann, wer sich regulatorisch nicht auf eine Seite des Trennstrichs zwischen öffentlich und privat zurückzieht.
Auf Belegstellen von Literatur konnte bei dieser ganz überwiegend neuen Rechtsmaterie weitgehend verzichtet werden. Das Literaturverzeichnis am Anfang des Bandes lässt aber keine Wünsche offen.
Alles in allem ist zu begrüßen, dass hier rechtzeitig ein „Beck´scher Kompakt-Kommentar“ zur Verfügung steht, der freilich schon in der Erstauflage über 850 Seiten umfasst. Hier dürfte schon die erste Neuauflage die 1000-Seiten Marke reißen.
Die Überschrift dieses Beitrags mag etwa schief sein, aber bei genauerem Hinsehen scheint es doch so, dass die Verordnung Daten insgesamt als etwas betrachtet, das fair verteilt werden soll – ob nun in öffentlicher oder privater Hand. Als wären Daten ein Gemeingut. Wir dürfen gespannt sein, ob mit dem Data Act in der EU der erfolgreiche Beginn gemacht ist, Datennutzungen fair zu verteilen.
Czychowski/Lettl/Steinrötter
Data Act (Kommentar)
Verlag C.H. Beck, 1. Auflage 2025
854 Seiten; 139,00 Euro
ISBN 978-3-406-82090-8