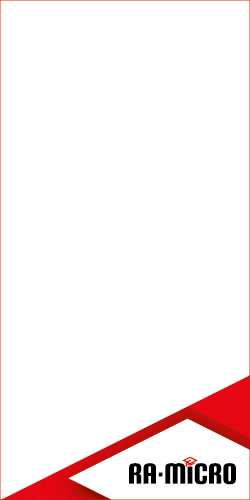Warum es keinen „Herbst der Reformen“ geben kann
Georg Cremer deckt in seinem neuen Buch Irrtümer und Verhaltensweisen in der Sozialpolitik auf
Matthias Wiemers
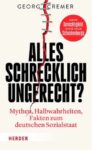 Zugegeben, von einem „Herbst der Reformen“ spricht Georg Cremer in seinem neuen Buch nicht – jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen. Das Werk erscheint aber nicht zufällig in diesem Herbst, denn der frühere langjährige Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes, ein habilitierter Volkswirt und anerkannter Fachmann mit erkennbarem ethischem Fundament, hat sein neuestes Buch nicht umsonst jetzt auf den Markt gebracht. Es ist zwar für ein Taschenbuch nicht gerade „billig“, aber Autor und Verlag zeigen damit, dass sie sogleich das Format des Taschenbuchs wählen auch, dass es ihnen um Verbreitung und nicht nur um Profit geht – und zu dieser Verbreitung wollen wir hier gerne beitragen.
Zugegeben, von einem „Herbst der Reformen“ spricht Georg Cremer in seinem neuen Buch nicht – jedenfalls ist es mir nicht aufgefallen. Das Werk erscheint aber nicht zufällig in diesem Herbst, denn der frühere langjährige Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes, ein habilitierter Volkswirt und anerkannter Fachmann mit erkennbarem ethischem Fundament, hat sein neuestes Buch nicht umsonst jetzt auf den Markt gebracht. Es ist zwar für ein Taschenbuch nicht gerade „billig“, aber Autor und Verlag zeigen damit, dass sie sogleich das Format des Taschenbuchs wählen auch, dass es ihnen um Verbreitung und nicht nur um Profit geht – und zu dieser Verbreitung wollen wir hier gerne beitragen.
Cremer hat schon eine Reihe instruktiver Bücher zur Sozialpolitik verfasst, bei denen es ihm immer um Befähigung der Einzelnen im Sozialstaat gegangen ist. Man muss ja – das gerade vom „Stadtbild“ einmal anders betrachtet – den Eindruck haben, dass es vor allem die langjährigen „Kunden“ des Sozialstaats sind, die oft in zweiter und dritter Generation und nicht durch eine etwas dunklere Hautfarbe auffallend, in besonders hohem Maße jede Befähigung und jeden Mut verloren haben, so dass ihnen nichts anderes einfällt, als sich von ohnehin meistens überforderten Mitarbeitern der Sozialverwaltung eben „verwalten“ zu lassen. Vor diesem Hintergrund erschient der neue Titel spannend, weil er Antworten darauf zu geben versprach, warum wir diese Sozialstaatsmisere haben – und wie wir vielleicht auch wieder dort herauskommen könnten.
Schon in der Einleitung des Bandes weist der Autor darauf hin, dass von ihm so genannte Sozialstaatsmythen Reformen blockieren. Einer dieser Mythen ist die Behauptung, der einstmals leistungsfähige Sozialstaat sei „durch neoliberale Verblendung“ nach und nach abgebaut worden. In der Tat wird kein Begriff so häufig missbraucht wie der des Neoliberalismus. Cremer stellt hingegen fest, der unterstellte Sozialabbau sei „trotz aller Widersprüchlichkeit der Sozialstaatsentwicklung empirisch schlicht nicht haltbar“. Dies folge bereits aus der Tatsache, dass pro Jahr fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung in Deutschland für den Sozialstaat verausgabt werde (S. 10).
Kapitel 1 ist dem Thema „unerfüllbare Erwartungen“ gewidmet, wo sogleich die Frage aufgeworfen wird „Leistungen rauf, Belastungen runter?“. Dass das nicht geht, muss jedem klar sein, aber Cremer stellt dar, wie die „Illusionsverstärkung durch Parteienkonkurrenz“ (S. 20 ff.) funktioniert. Und er zeigt auch, wie weit die Empathie der Mitte für den unteren Rand der Gesellschaft trägt: nicht sehr weit, wie Cremer zeigt (S. 23 ff.).
Es erscheint klar, dass Sozialpolitik priorisieren muss, und dieser Frage ist das zweite Kapitel gewidmet. Hier werden einige Reformoptionen bzw. bereits durchgeführte Reformen diskutiert und schonungslos in ihrer Wirkung decouvriert. So würden etwa durch den vollständigen Verzicht auf Kindergartengebühren die „Reichen“ überproportional entlastet, worunter die Qualität litte, weil weniger Personal dauerhaft beschäftigt werden kann (S. 35 ff.). Der Rezensent erinnert sich insoweit noch gut daran, dass vor knapp 15 Jahren das seinerzeit notorisch klamme Rheinland-Pfalz die Kindergartengebühren abschaffte – und die Nettozahler aus Hessen sollten es über den Länderfinanzausgleich bezahlen! Fachlich überzeugt hier das Argument Cremers, der darlegt, dass eine „sehr frühe Kinderbetreuung und die langen, zum Teil extrem langen Betreuungszeiten“ Kindern nur zuträglich seien, wenn sie verlässliche Bindungsbeziehungen zu den Fachkräften aufbauen könnten (S. 36).
Was von einer Pflegevollversicherung zu halten ist, die immer noch gefordert wird, obwohl jeder einigermaßen logisch denkende Mensch wissen muss, dass es die Beschäftigung in unserem Land noch teurer machen würde, zeigt Cremer in allen Facetten auf (S. 36 ff.). Er benutzt hier (und öfter) den schönen Begriff des Zielgruppenmissbrauchs: Vertreter aus Sozialverbänden wie auch aus dem Mittelstand instrumentalisieren immer wieder Ärmere, um selbst nicht bezahlen zu müssen. Wohl hält es Cremer für sinnvoll, gestaffelte Freibeträge bei der Anrechnung der Rente auf die Hilfen zur Pflege nach dem SGB XII anzurechnen, damit diejenigen, die ihr Leben lang (schlecht bezahlt) gearbeitet haben, mehr Geld zur Verfügung haben als diejenigen, für die das nicht gilt (Hier fällt einem sogleich ein berühmter Spruch des Sozialpolitikers Karl Josef Laumann ein, den ich hier nicht zitierten will). Der Vorschlag erscheint bedenkenswert, weil unsere Gesellschaft auch schlechtbezahlte Arbeit braucht und entsprechende Anreize, dass diese Arbeiten auch künftig erledigt werden. Weil sie sich dauerhaft im Vergleich zu Grundsicherungsleistungen lohnen. Zum Schluss wird die Frage nach „Transferzahlungen oder Hilfen durch bessere soziale Dienste?“ aufgeworfen – und das Startchancen-Programm der Ampel-Regierung gelobt. Ein Zitat aus diesem Kontext: „Wie auch immer die materiellen Hilfen für Familien mit niedrigen Einkommen gestaltet werden, ihr Beitrag zur dauerhaften Vermeidung von Armutslagen wird eher bescheiden sein, wenn nicht Kinder aus prekären Milieus besser und früher erreicht werden“ (S. 42). Recht hat er!
Das Zentralkapitel des Bandes ist tatsächlich Kapitel 2, weil es dann mit insgesamt 22 Mythen des Sozialstaats weitergeht, die Cremer hier auflöst und die jeder zur Kenntnis nehmen sollte, der noch ein Wählerkreuzchen wegen sozialpolitischer Versprechen machen will. Es beginnt mit „M 1“ „Die Mitte schrumpft und schrumpft“ und endet mit M 22 „Die Migration sprengt das Sozialbudget“. Gerade bei M 22 mag mancher anderer Meinung sein, weil das Erwerbspotential der Zuwanderer im Hinblick auf die Sozialleistungssysteme möglicherweise unterdurchschnittlich ist, so dass die Systeme hierdurch nicht gerettet werden können. Dennoch stimmt die klare Aussage Cremers, wonach es unredlich sei, die ungelösten Finanzierungsprobleme des Sozialstaats bei Flüchtlingen und Migranten abzuladen (S. 113).
Das dritte Kapitel fragt nach den Sozialverbänden als „Echokammern der Unzufriedenheit“. Hier stellt er zu Beginn klar, dass eine Homogenität der zahlreichen Sozialverbände nicht gegeben sei. Gleichwohl wird im Rahmen der Darstellung insgesamt deutlich, dass wohl jedenfalls fünf große Sozialverbände zu Lösungen wenig beizutragen haben (die Caritas gehört übrigens nicht dazu, und es zeigt sich, dass man auch die Kirchen nicht unterschiedslos in einen Topf werfen darf).
In Kapitel 4 legt der Autor dar, dass die Medien als kritisches Korrektiv gegen die Sozialstaatsmythen ausfallen. Dies verwundert nicht, da man sich mit Sozialpolitik eben vertieft befassen muss und diese bedeutend komplizierter ist als beispielsweise Wirtschaftspolitik.
Kapitel 5 befasst sich mit der Behauptung vieler Politiker, gute Politik helfe weiter, wobei der Autor hier die Probleme des politischen Systems darlegt, angefangen von der konstatierten Entkopplung von Lage und Wahrnehmung bis zur Beschreibung des Phänomens, dass der Staat als Lieferservice gesehen wird.
Kapitel 6 fragt danach, was künftig sozialer Fortschritt heißen kann, und Cremer weist jedenfalls Vorstellungen von weiterer Expansion des Sozialstaats zurück, und zudem wendet er sich gegen eine totale Sozialisierung von Kosten, die bislang Familien und Paare füreinander übernommen haben. Parteiprogramme der jüngsten Zeit – auch das der CDU – werden als Oppositionsprogramme bezeichnet. Gegen Ende heißt es: „Die Zeitenwende könnte die Chance bieten, unter dem Druck der Anpassungszwänge eine konzeptionelle Debatte darüber zu eröffnen, was sozialer Fortschritt heute bedeuten kann, wenn es nicht mehr möglich ist, den expansiven Pfad der Sozialpolitik fortzusetzen.“
Kapitel 7 ist einem besonderen Anliegen des Autors seit langem gewidmet: „Verdeckte Armut bekämpfen“. Dort heißt es etwa: „Es wird geschätzt, dass jene, die ihren Hilfeanspruch nicht geltend machen, im Durchschnitt etwa 220 Euro im Monat liegen lassen“ (S. 166). Diese Sprache befremdet etwas. Es mag doch gute Gründe geben, einen Anspruch, der einem zusteht, nicht wahrzunehmen. Richtig ist aber, dass viele Menschen über ihre sozialstaatlichen Ansprüche nicht richtig informiert sind und hier die Information verbessert werden muss. Wie Cremer aber an anderer Stelle auch schreibt, findet die Information in nicht ausreichendem Maße statt, weil die Behörden hierzu gar nicht in der Lage sind. Er fordert schließlich, die Diskreditierung der Grundsicherung zu stoppen. Auch wendet er sich gegen die Gleichsetzung von Grundsicherungsbezug und Armut. Hier ist etwas daran, weil – wie Cremer zu recht nachweist – eine Erhöhung des Grundleistungsbezugs zugleich zu einer erhöhten Bedürftigkeit und damit zu einer Erhöhung der Leistungsbezüge führt. Damit würde die Zahl der Armen steigen. Cremer fordert „Fairness für den unteren Rand der Mitte“ (Kapitel 8). Er stellt zwar fest, dass sich Arbeit lohne, das sog. Lohnabstandsgebot also eingehalten sei, es sich aber zu wenig lohne. Und hier müsse nachgebessert werden. Cremer räumt ein, dass er sich bei seiner früheren Befürwortung der Kindergrundsicherung geirrt habe; die Komplexität der geplanten Reform sei heillos unterschätzt worden (S. 190).
Der Sozialstaat müsse bürgerfreundlich sein, ohne zu bevormunden, ist das Thema des neunten Kapitels. Dies ist eine Thematik, die etwa auch bei den Staatsreformern um Thomas de Maiziere angekommen ist. Auch der Rezensent kann dies aus seiner Erfahrung mit dem Sozialgesetzbuch insbesondere in der akademischen Lehre bestätigen. Das SGB ist eben kein zweites BGB, sondern konzeptionell überfrachtet. Hier soll nur eines der von Cremer gebrachten Beispiele zitiert werden, nämlich die Kontrollen im Pflegesektor (S. 207), um die Absurditäten realexistierender Sozialpolitik zu verdeutlichen (der Kindergartensektor wäre ein weiteres Beispiel): „Die Kontrollen im Pflegesektor sind ein gutes Beispiel für diese Wechselwirkung zwischen öffentlicher Erregung und Überregulierung. In Reaktion auf Missstände hat der Gesetzgeber 2009 ein System der Benotung der Pflegeheime in Anlehnung an Schulnoten eingeführt, um Transparenz über die Pflegequalität herzustellen. Die Benotung beruhte aber vorrangig auf der Dokumentation, die die Einrichtungen selbst erstellten. Mittels eines peniblen Dokumentationswesens konnten auch mittelmäßige Pflegeeinrichtungen sehr gute Noten erreichen. Somit bauten alle Heimträger die Dokumentation aus. Bei Einführung im März 2010 erreichten die Pflegeheime „nur“ eine Durchschnittsnote von 2,1, aber keine drei Jahre später gab es, glaubt man dem geduldigen Papier, nur noch exzellente Heime. Die Durchschnittsnote stieg auf 1,2. Es kam vor, dass ein Heim wegen eklatanter Mängel geschlossen werden musste, das kurz zuvor mit einer Bestnote bewertet worden war. Die Dokumentation kostete viel Zeit, die in der Pflege fehlte; dies frustrierte die Pflegekräfte.“ Und dieser Unsinn, so möchte man hinzufügen, ändert sich auch nicht, wenn man nun das Papier hinwegdigitalisiert.
Kapitel 10 ist überschrieben mit „Ein Sozialstaat, der Menschen stark macht“ und betont das schon eingangs hier erwähnte Grundanliegen des Autors Georg Cremer. Gleich in der ersten Überschrift heißt es dann, Eigenverantwortung sei kein neoliberaler Wert (vielleicht schon, möchte man hinzufügen, aber er ist eben nicht von den Neoliberalen gepachtet, sondern kann auch von anderen benutzt werden). In diesem Kapitel wird das Phänomen entfaltet, dass diejenigen – insbesondere Eltern -, die sich ihrer eigenen Kompetenzen bewusst sind und die sich etwas zutrauen, eher Hilfsangebote wahrnehmen und annehmen. Cremer nennt es ein Präventionsdilemma, dass Hilfsangebote eher von Menschen mit höherem Bildungsgrad genutzt werden.
In einem Resumee (Kapitel 11) setzt sich Cremer für eine Sozialstaatsdebatte ein, die nicht den Feinden der Demokratie in die Hände spielt. Lassen wir mal die Frage außen vor, wer überhaupt ein Feind der Demokratie ist (Cremer benennt mehrere Parteien, müsste aber vielleicht noch mehrere nennen). Cremer führt jedenfalls aus: „Die Kräfte, die eine liberale Demokratie erhalten wollen, verorten sich selbst unerschütterlich auf der Seite des Guten, es sind stets die anderen, die die Demokratie gefährden. Aber sie sollten sich einer selbstkritischen Debatte stellen, wieweit sie selbst Narrative des ständigen Politikversagens verfestigen. Wenn Sozialverbände als Echokammern der Unzufriedenheit fungieren, türmen sie Erwartungen auf, die Politik nicht erfüllen kann. Das hilft populistischen Kräften. Eine wesentliche Motivation, dieses Buch zu schreiben, war mein Wunsch, zu einer solchen selbstkritischen Debatte beizutragen“ (S. 223). Damit wollen wir es belassen und zur Lektüre anregen. Kein mündiger Bürger sollte sich von Interessenträgern und Politikern, die zufällig in die einschlägigen Gremien geraten sind, etwas vormachen lassen!
Georg Cremer
Alles schrecklich ungerecht? Mythen, Halbwahrheiten, Fakten zum deutschen Sozialstaat
Herder Verlag, 1. Auflage 2025
256 Seiten; 22,00 Euro
ISBN: 978-3-451-07361-8