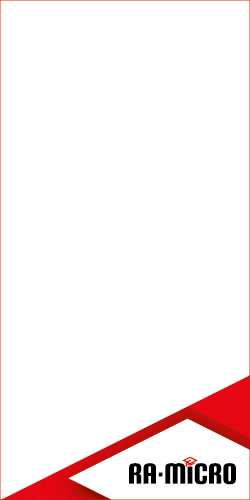Kein Kapitalmarkt ohne Regulierung
Das „Handbuch MiCAR“ versucht, eine komplexe Materie greifbar zu machen
Matthias Wiemers
 Der Bürger mag ein ungutes Gefühl dabei haben: Die gesamte Bevölkerung einschließlich der kleinen Gewerbetreibenden steht den digitalen Intermediären, aber jedenfalls auch den staatlichen Behörden zunehmend völlig nackt gegenüber. Bargeld soll letztlich abgeschafft werden und wird geradezu als kriminell und schmutzig denunziert, während sich die großen (und zunehmend auch kleineren) Verbrechernaturen dieser Welt ins Darknet oder die Kryptowährung flüchten. Was dies für die staatsbürgerliche Gleichheit und die Privatheit gleichermaßen bedeutet, wird von Politikern fast vollständig ausgeblendet („Digitalisierung first – Bedenken second“ titelte eine aussterbende Partei vor einigen Jahren).
Der Bürger mag ein ungutes Gefühl dabei haben: Die gesamte Bevölkerung einschließlich der kleinen Gewerbetreibenden steht den digitalen Intermediären, aber jedenfalls auch den staatlichen Behörden zunehmend völlig nackt gegenüber. Bargeld soll letztlich abgeschafft werden und wird geradezu als kriminell und schmutzig denunziert, während sich die großen (und zunehmend auch kleineren) Verbrechernaturen dieser Welt ins Darknet oder die Kryptowährung flüchten. Was dies für die staatsbürgerliche Gleichheit und die Privatheit gleichermaßen bedeutet, wird von Politikern fast vollständig ausgeblendet („Digitalisierung first – Bedenken second“ titelte eine aussterbende Partei vor einigen Jahren).
Mitten im Zentrum des Problems der intransparenten Finanztransaktionen stehen die so genannten Kryptowerte, deren Regulierung sich die EU zum Glück angenommen hat.
„Markets in Crypto Assets Regulation“, so lautet, was MiCAR abgekürzt meint. Ausweislich des Vorworts des Herausgebers sind die Finanzinstrumente der Kryptowerte bereits Standardrepertoire der Kapitalmarktrechtler, während die EU mit der MiCAR-Verordnung einen ersten Vorstoß zur Regulierung dieser Instrumente wagte.
Das Handbuch zeichnet einerseits chronologisch die Entwicklung der MiCAR-Verordnung nach und zeigt anderseits in Einzelkapiteln explizit thematische Schwerpunkte auf. Das letzte Kapitel (15) zeigt anhand der USA, Singapore, Liechtenstein, der Schweiz, der Türkei und China vergleichend sechs Jurisdiktionen auf, die sich mehr oder weniger weitgehend ebenfalls bereits der Regulierung dieser neuen Finanzmarktphänomene angenommen haben.
Kapitel 1 beginnt selbstverständlich mit der Umschreibung des Anwendungsbereichs. Hier schon – wie in allen Folgekapiteln auch – beginnen die Ausführungen mit einer eng beschriebenen Literaturübersicht. Sodann wird auf gut 70 Seiten die teils heftig umstrittene Bemessung des Anwendungsbereichs der Verordnung vorgenommen.
Die „Begriffsbestimmungen“ in Kapitel 2 umfassen gar knapp 120 Seiten. Kapitel 3 ist speziell andere Kryptowerten als vermögenswerte-referenzierte Token und E-Geld-Token gewidmet, während Kapitel 4 eben „vermögenswertreferenzierte Token“ und Kapitel 5 „E-Geld-Token“ behandeln. Bei Kapitel 5 stellt sich natürlich sogleich die Frage, ob der seit Jahren von der EU geplante „digitale Euro“ wohl hierunter fällt. Sofern allerdings dieser „digitale Euro“ als eine amtliche Währung anzusehen wäre, so wäre er – wie wir in Kap. 5 Rdnr. 52 lernen – gerade kein E-Geld-Token, da er sich nicht auf eine amtliche Währung bezieht, sondern eben selbst eine solche darstellt.
Kapitel 6 beschäftigt sich sodann mit der Zulassung und den allgemeinen Pflichten von Kryptowerte-Dienstleistern, Kapitel 7 referiert „Pflichten in Bezug auf spezifische Kryptowerte-Dienstleistungen“. Kapitel 8 stellt die „Haftung für Whitepaper“, mit denen vor allem Anbieter von Kryptowährungen in eine spezielle Prospekt-Haftung (vgl. Rdnr. 210) genommen werden, die allgemeine Prospekthaftung nach BGB allerdings nicht ausschließt.
Kapitel 9 widmet sich den Verbraucherschutzrecht der MiCAR, Kapitel dem Schicksal von Kryptowerten in Vollstreckung und Insolvenz.
Die MiCAR-Verordnung enthält auch kartellrechtliche Regelungen. Diese werden im elften Kapitel einer Darstellung unterzogen. Kapitel 12 ist den Befugnissen und Sanktionen der Aufsichtsbehörden gewidmet, und Kapitel 13 stellt explizit „Grenzüberschreitende Kryptowerte-Dienstleistungen“ dar. Hierbei geht es um Unternehmen aus EWR-Mitgliedstaaten, die sich auf dem neu geschaffenen europäischen Binnenmarkt für Kryptowerte betätigen wollen (Rdnr. 2).
Nicht überraschend ist das 14. Kapitel zu „MiCAR und Geldwäscheprävention“, bevor das bereits erwähnte Kapitel zur Rechtsvergleichung den Band beschließt.
Alles in allem: Ein Werk für Spezialisten des Kapitalmarktrechts, das als unentbehrlich bezeichnet werden muss, will man sich dieses Teilrechtsgebiet systematisch erarbeiten.
Am vorliegenden Beispiel zeigt sich über die Spezialfragen hinausgehend erneut eines: Mag man auch die „Regulierungswut“ der EU, die häufig nur deswegen schwer erträglich ist, weil die Mitgliedstaaten immer noch etwas hinzufügen müssen, oft beklagen: In Summe nimmt sich die EU genau den Themen an, die der einzelne Mitgliedstaat längst nicht mehr allein zu regeln imstande ist. Weil er entweder zu klein ist, oder weil im demokratischen System der Mitgliedstaaten die „Technologieoffenheit“ so weit geht, dass notwendige Regulierungen nicht mehr angegangen und stattdessen Phantomdebatten geführt werden, mit denen man die Zustimmung des Souveräns zu erheischen sucht.
Meier (Hrsg.)
Handbuch MiCAR. Europäische Regulierung der Kryptowerte
Erich Schmidt Verlag, 2025
1.148 Seiten; 148,00 Euro
ISBN: 978-3-503-23963-4