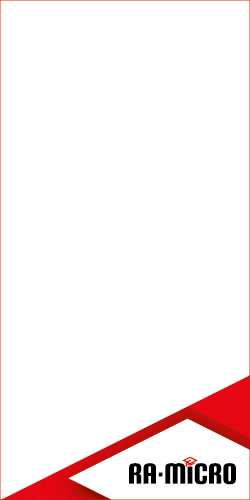Spuren in die Gegenwart
Deutsche Auswanderer und Weltenbummler haben Lateinamerika maßgeblich mitgeprägt – nicht immer zum Segen des Kontinents
Benedikt Vallendar

Deutscher Schriftzug an einem Postamt im Chaco, Paraguay (Foto: Vallendar)
Nur oberflächlich gesehen ist Lateinamerika ein spanisch-portugiesisch geprägter Kontinent. Denn in Wirklichkeit waren es Kulturen und Nationen aus mehrerer Herren Länder, die dort ihre Spuren hinterlassen haben, etwa in der Baukunst, der Philosophie und im Bildungswesen, und ganz zu schweigen von der reichhaltigen südamerikanischen Küche, die zumindest in der Art ihrer Zubereitung oft stark auf ausländische Einflüsse zurückgeht.
Nach der Entdeckung Lateinamerikas durch Christoph Kolumbus im Oktober 1492 waren auch zahlreiche Deutsche daran beteiligt, die „Neue Welt“ in die heute westliche zu integrieren. In ihrem neuesten Buch „Die Kaiserin von Galapagos. Deutsche Abenteuer in Lateinamerika“ – in Anspielung an eine tragisch-komische Amour à trois unter Deutschen auf den zu Ecuador gehörenden Galapagos-Inseln zu Beginn der 1930er Jahre – beschreibt die Hispanistin Michi Strausfeld in höchst anschaulicher Weise, wie deutsche Pioniere und Missionare den Kontinent zu einem Konglomerat verschiedener Kulturen und Eldorado für Wagemutige, Investoren und ambitionierte Visionäre gemacht haben; ein erzählerisches Meisterwerk, das zeigt, dass auch die als schwerfällig geltende deutsche Sprache in Übersee ihre Wurzeln geschlagen hat und zum festen Bestandteil des Subkontinents geworden ist. Anschaulich zu sehen ist dies etwa im deutschsprachigen Chaco, im Norden Paraguays, wo aus Norddeutschland stammende Mennoniten seit knapp 100 Jahren mit Milcherzeugnissen jedweder Art wesentlich zur Wirtschaft des Landes beitragen. Und dabei auf enge Zusammenarbeit mit der lokalen, indigenen Bevölkerung setzen.
Die Lokalverwaltung ist im Chaco seit Jahrzehnten in Händen deutscher Muttersprachler. Zudem gibt es im Chaco gut ausgebaute Straßenpisten, ein solides Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystem mit drei deutschen Gymnasien und Sekundarschulen; aufgebaut von deutschen Pionieren und beseelt von der Mission, das Evangelium in die Welt zu tragen.

Im Chaco werden auch Produkte aus Deutschland verkauft (Foto: Vallendar)
Deutsche waren auch im Schlepptau katholischer Missionsorden, die seit Beginn des 16. Jahrhunderts nach Lateinamerika kamen, um dort als Seelsorger, Völkerkundler und Chronisten zu wirken, darunter der Priester und Ethnologe Martin Gusinde (1886 – 1969), den es schon als Dreizehnjährigen in ein Priesterseminar gezogen hatte. Und apropos Priester. „Vieles von dem, was wir heute über Lateinamerikas Geschichte wissen, verdanken wir den katholischen Orden“, sagt der Romanist Dietrich Briesemeister, einst Professor an der FU Berlin und Direktor des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI), das zur Stiftung preußische Kulturbesitz gehört. Im 16. Jahrhundert errichteten deutsche und spanische Jesuiten in abgetrennten Gebieten im Norden Argentiniens, sogenannten „Reduktionen“ religiös motivierte Formen des Zusammenlebens mit dort ansässigen Indios, die dadurch vor dem Zugriff spanischer Kolonisten geschützt werden sollten. Die baulichen Überreste dieser christlichen Pionierarbeit im Grenzgebiet zwischen Paraguay und Argentinien sind heute beliebte Touristenattraktionen, Devisenbringer und wichtige Zeugnisse der Geschichte. Zwischen riesigen Grünflächen ragen imposante Mauerreste aus dem Boden und geben doch nur einen Eindruck von dem, wie sich das Leben hier vor dreihundert Jahren abgespielt hat; wie Menschen aus verschiedenen Kulturen friedlich zusammenarbeiteten, ruhend in der gemeinsamen Überzeugung, dass ihr katholischer Glaube die Neue Welt zu einer besseren hätte machen können. Ein Glaube, dessen materielle und immaterielle Segnungen die Philologin Maria Elvira Roca Bareas 2022 in ihrem vielbeachteten, auch auf Deutsch erschienenen Sachbuch „Imperiofobia“ hinreichend beschrieben hat. Und dafür großes Lob erhalten hat, etwa von Mario Vargas Llosa, dem peruanischen Literaturnobelpreisträger von 2010.
Die Vision einer besseren Welt durch den christlichen Glauben war auch das Lebenswerk des 2009 verstorbenen deutschen Missionars Pater Josef Marx SVD aus Sankt Augustin. In Mexiko und im Norden Argentiniens hatte der Steyler Pater fast zwei Dutzend weiterführende Schulen für die indigene Bevölkerung errichten lassen, zudem eine Radiostation und eine Kräuterfabrik, unterstützt u.a. vom Daimler-Benz-Konzern, mit dessen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche der Pater eng befreundet war. Zetsche hatte unter anderem geländegängige Mercedes-Busse spendiert, mit denen seither Indiokinder aus entlegenen Dörfern zur Schule gebracht werden.
Und dennoch ist es vor allem Spanien und seiner Kirche zu verdanken, dass Lateinamerika heute – nach den Worten des früheren Papstes Johannes Paul II. (1920 – 2005) – als „katholischer Kontinent“ gilt; auch wenn dort mehr und mehr andere christliche Strömungen, auch aus Deutschland für sich in Anspruch nehmen, zu verbreiten, was sie unter „Glauben“ verstehen; zumeist evangelikale Gruppen, die auf massive finanzielle Unterstützung aus Australien, der Schweiz und den USA setzen können und damit der katholischen Kirche das Leben schwer machen, etwa in Brasilien und Guatemala.
Zur historischen Wahrheit gehört allerdings auch, dass mit Hilfe kirchlich-katholischer Kreise NS-Kriegsverbrechern nach 1945 die Flucht nach Lateinamerika gelang. Ob Adolf Eichmann, Klaus Barbie oder der KZ-Arzt Josef Mengele, allesamt getaufte Katholiken, die über die so genannte „Rattenlinie“ in Bolivien, Brasilien und Argentinien eine neue Heimat fanden, derweil Ermittlungsbehörden weltweit nach ihnen fahndeten. Angeblich, weil diese Herren gegen den „Kommunismus“ gekämpft hatten, wobei in Wirklichkeit das Blut von Millionen Menschen an ihren Händen klebte. Die Welt vor dem Kommunismus bewahrt zu haben, war auch das Argument des pädophilen und 2010 in Haft gestorbenen Sektengründers Paul Schäfer, der sich als „Christ“ verstand und in Chile Zugang zu höchsten politischen Kreisen fand. Das Gelände seiner „Colonia Dignidad“ diente in den 1970er Jahren dem Inlandsnachrichtendienst DINA und dem Militär zu Folterzwecken an Oppositionellen. Richtig publik wurden die Machenschaften, nachdem der langjährige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU), einst enger Vertrauter Helmut Kohls und als Enfant terrible der Union verschrien, durch Privatreisen und anschließende TV-Interviews auf das Schicksal der dort seit Jahrzehnten einsitzenden und stupide vor sich hin malochenden Deutschen hingewiesen hatte. Seit 1988 nennt sich das Gelände der früheren Sekte „Villa Baviera“ und gilt als beliebter Touristenhotspot für Familien und Weltenbummler. Speisekarten, Folklore und Informationen zu Deutschland sind allerdings vor allem auf Bayern fokussiert, wo Katholiken ja bekanntlich bis heute in der Mehrheit sind.