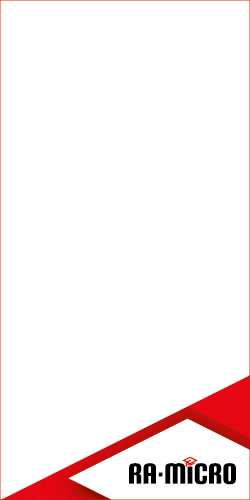Korruption in Deutschland: sowas gibt es doch
Gertrude Lübbe Wolf beschreibt ein Phänomen, das zu lange tabuisiert wurde
Matthias Wiemers
 „Einsicht ist der erste Weg zur Besserung“ sagt der Volksmund. Es existiert in diesem Land allerdings ein Mythos, wonach insbesondere staatliche Bedienstete unbestechlich sind, wir also wenigstens im eigenen Lande mit Korruption wenig zu tun haben. Allerdings hat schon vor etwa 30 Jahren der Frankfurter Bauamtsskandal etwas anderes gezeigt und wissen wir, dass im von „Westdeutschland“ gepäppelten Westberlin immer schon ein korruptiver Sumpf herrschte, weil dort immer wieder Bauprojekte verwirklicht wurden, an denen die Allgemeinheit wenig Interresse hatte. Und das Gesundheitswesen lädt offenbar derart zum Missbrauch ein, dass 2016 aus Anlass des Gesundheitswesens des Korruktionsstrafrecht verschärft wurde. Woher nehmen eigentlich die Leugner des Phänomens Korruption in Deutschland die Überzeugung, dass wir hier gut aufgestellt seien – bei einem immer größeren öffentlichen Sektor mit immer mehr öffentlich Bediensteten (und potentiell immer mehr Enttäuschten, an denen etwa wieder ein „politischer Freund“ der Einflussreichen oder auch nur eine Frau vorbeigezogen ist, die er jedenfalls subjektiv für weniger qualifiziert hält), immer mehr Vorschriften ohne inneren Sinn und vor allem einem marginalisierten Amtsethos, das weder eine geschlossene religiöse Basis noch einen einheitlichen Kanon an Erziehung und Erfahrungen in einer zunehmend heterogenisierten Gesellschaft vorfindet, auf dem es gedeihen kann. Äußere Vorschriften und ihre kaum zu realisierende Überwachung (durch noch mehr Personal) können intrinsische Motivationen jedenfalls nicht ersetzen. Vor diesem Hintergrund war es – die recht verbreiteten Arbeiten von Wolfgang Schaupensteiner und vor allem Britta Bannenberg liegen nun schon lange Zeit zurück – an der Zeit, dass einmal eine bekannte Autorin, die als Wissenschaftlerin einen guten Ruf genießt und gleichzeitig – trotz seinerzeitiger Nominierung durch die SPD zum BVerfG – auch bei der CDU Gehör findet, dass sich also einmal eine Person des Themas Korruption annahm, die weder im Elfenbeinturm der Wissenschaft steckt noch reine Praktikerin ist, sondern sich vielmehr auf das stützen kann, was heute noch als gesicherte „politische Mitte“ gilt – auch wenn dieser Begriff zunehmend ins Gerede gekommen ist. Doch genug der Vorrede, kommen wir zum neuen Werk von Gertrude Lübbe-Wolff.
„Einsicht ist der erste Weg zur Besserung“ sagt der Volksmund. Es existiert in diesem Land allerdings ein Mythos, wonach insbesondere staatliche Bedienstete unbestechlich sind, wir also wenigstens im eigenen Lande mit Korruption wenig zu tun haben. Allerdings hat schon vor etwa 30 Jahren der Frankfurter Bauamtsskandal etwas anderes gezeigt und wissen wir, dass im von „Westdeutschland“ gepäppelten Westberlin immer schon ein korruptiver Sumpf herrschte, weil dort immer wieder Bauprojekte verwirklicht wurden, an denen die Allgemeinheit wenig Interresse hatte. Und das Gesundheitswesen lädt offenbar derart zum Missbrauch ein, dass 2016 aus Anlass des Gesundheitswesens des Korruktionsstrafrecht verschärft wurde. Woher nehmen eigentlich die Leugner des Phänomens Korruption in Deutschland die Überzeugung, dass wir hier gut aufgestellt seien – bei einem immer größeren öffentlichen Sektor mit immer mehr öffentlich Bediensteten (und potentiell immer mehr Enttäuschten, an denen etwa wieder ein „politischer Freund“ der Einflussreichen oder auch nur eine Frau vorbeigezogen ist, die er jedenfalls subjektiv für weniger qualifiziert hält), immer mehr Vorschriften ohne inneren Sinn und vor allem einem marginalisierten Amtsethos, das weder eine geschlossene religiöse Basis noch einen einheitlichen Kanon an Erziehung und Erfahrungen in einer zunehmend heterogenisierten Gesellschaft vorfindet, auf dem es gedeihen kann. Äußere Vorschriften und ihre kaum zu realisierende Überwachung (durch noch mehr Personal) können intrinsische Motivationen jedenfalls nicht ersetzen. Vor diesem Hintergrund war es – die recht verbreiteten Arbeiten von Wolfgang Schaupensteiner und vor allem Britta Bannenberg liegen nun schon lange Zeit zurück – an der Zeit, dass einmal eine bekannte Autorin, die als Wissenschaftlerin einen guten Ruf genießt und gleichzeitig – trotz seinerzeitiger Nominierung durch die SPD zum BVerfG – auch bei der CDU Gehör findet, dass sich also einmal eine Person des Themas Korruption annahm, die weder im Elfenbeinturm der Wissenschaft steckt noch reine Praktikerin ist, sondern sich vielmehr auf das stützen kann, was heute noch als gesicherte „politische Mitte“ gilt – auch wenn dieser Begriff zunehmend ins Gerede gekommen ist. Doch genug der Vorrede, kommen wir zum neuen Werk von Gertrude Lübbe-Wolff.
Das erste Kapitel beschäftigt sich auf gut 35 Seiten erst einmal nur mit der Bestimmung des Begriffs der Korruption. Lübbe-Wolff legt sich im Ergebnis nicht auf einen bestimmten Korruptionsbegriff fest, sondern beschreibt vielmehr die Vor- und Nachteile der bekannten Bestimmungsversuche.
Im schon wegen deutlich geringerem Fußnotenapparat wesentlich knapperen zweiten Kapitel werden Gründe für die Schädlichkeit von Korruption aufgeführt. Diese gliedern sich in solche für das politische System und solche für die Wirtschaft. Die übrigens hier aufgeführten Beispiele der überdimensionierten Straßen- und Flughafenanlagen lassen sich übrigens auch zahlreich in Deutschland finden – vor allem im Süden der Republik. Dies muss allerdings nicht in jedem Fall auf Korruption zurückzuführen sein, sondern kann auch mit dem Zusammenwirken verschiedener „Fehleinstellungen“ im politischen System zu tun haben, die es einzelnen politischen Entitäten einfacher machen, ihr vermeintliches Gemeinwohlinteresse schneller und effektiver durchzusetzen. Wenn wir hier nicht ins Detail gehen wollen, nennen wir nur die aktuell wieder diskutierte Tatsache, dass in den Küstenländern Windstrom produziert wird, der im Süden der Republik abgenommen wird und wo Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum überproportional für die Leitungskosten zur Kasse gebeten werden. Wettbewerbsföderalismus ist etwas für Sonntagsreden, aber nicht angebracht, wenn „Nehmerländer“ für sich eine Wettbewerbschance sehen. Wer keine wirksamen Regelungen gegen „Hoflieferantentum schafft, wird es stets mit Fehlleistungen zu tun haben.
Auf gut einhundert Seiten – Kern der Studie – werden sodann „Daten und Einschätzungen zur Entwicklung der Korruption“ ausgebreitet, und zwar bezüglich Deutschland, EU und international. Der vierte Abschnitt ist hier am interessantesten, weil einem vieles davon gegenwärtig sogleich bekannt vorkommt. Es werden „Aktuelle Risikofaktoren“ vorgestellt, und zwar:
• Internationalisierung,
• Wachsende geopolitische Spannungen,
• Interne politische Polarisierung, Entdemokratisierung, Rechtsstaatsabbau,
• Organisierte Kriminalität,
• Komplexität der Entscheidungsvorgänge,
• Migration,
• Entwicklung wirtschaftlicher Ungleichheit und
• Krisen- und Krisenbewältigungspolitik.
Insbesondere die ganze „Corona-Kriminalität“ und schlechte Entscheidungen bei gleichzeitig nicht ausreichender Vorsorge müssen uns vor Augen führen, dass der Staat nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren sollte. So sind etwa die Kassen für Kurzarbeitergeld leer, so dass unser Land künftig etwa mit diesem Instrument nicht mehr so agieren kann. Grundrechte wurden während der Pandemie leichter Hand eingeschränkt, aber Anzeichen, dass dies künftig nicht mehr in diesem Asumaß nötig sein wird, fehlen völlig. Bei Lübbe-Wolff wird u. a. der „Corona-Wiederaufbaufonds“ kritisiert, weil die Vergabe von EU-Mitteln „hochgradig korruptionsanfällig“ sei (S. 155). Die völlige Sinnlosigkeit einer derartigen Neuverschuldung, wenn man doch demnächst schon wieder mit der nächsten Krise rechnen muss, arbeitet die Autorin aber nicht heraus. Das war auch nicht ihr Thema.
Im Kapitel IV entfaltet Lübbe-Wolff ihre These der „Problemverleugnung als Hindernis wirksamer Korruptionsbekämpfung“, wo zunächst kleine Fortschritte insoweit gesehen werden, als man sich mit bestimmten Einlassungen wie so etwas wie Korruption gebe es in Deutschland nicht, inzwischen eher lächerlich mache, weil das Problembewußtsein in der öffentlichen Meinung sich verändert habe.
Dann werden aber doch eine ganze Reihe von Aufmerksamkeitsdefiziten dargestellt, die je für sich schlüssig präsentiert werden: Blindheit für eigene Risiken und mangelnde Aufmerksamkeit für Korruptionsrisiken bei den „Guten“ (Medien, NGOs und Justiz).
Wenn nun im V. Kapitel “Moralismus als Hindernis wirksamer Korruptionsbekämpfung“ ausgemacht wird, so wird darin faktisch auch gezeigt, dass Moralismus nicht immer nur bei bestimmten politischen Gruppierungen zu vermuten ist, sondern es sich um ein allgemeingesellschaftliches Phänomen handelt
Mindestens so wichtig wie die Ursachenbekämpfung ist die Bekämpfung von Scheinlösungen. Daher hat die Autorin im VI. Kapitel über „Regelungsillusionen als Hindernis wirksamer Korruptionsbekämpfung“ ausgemacht und beschreibt darin zunächst das Problem, dass oftmals nur der Papierform genügt wird. Lübbe-Wolff rügt den mangelnden Praxisbezug von Regelungen und zeigt sodann mangelnde Aufmerksamkeit für Vollzugs- und Effizienzfragen auf. (Zu recht wird nebenher darauf hingewiesen, dass die EU-Kommission ihre Kompetenzen überschreitet, wenn sie in einem Richtlinienvorschlag allen Mitgliedstaaten die Schaffung einer oder mehrerer spezialisierter und unabhängiger, mit Ermittlungsbefugnissen ausgestatteter Behörden zur Korruptionsbekämpfung vorgeben wolle (S. 242). Schließlich wird eine deutsche „Transparenzaversion“ insbesondere in Bezug auf personenbezogene Daten ausgemacht. Zwar wird man sagen müssen, dass Transparenz nicht immer und überall ein Eigenwert zukommt, aber die Bedeutung des Kriteriums der Personenbezogenheit von Daten hat im Zuge einer immer weitergehenden „Digitalisierung“ ohnehin an Bedeutung verloren. Lübbe-Wolff jedenfalls weist darauf hin, dass der Datenschutz inzwischen auch im Europarecht Eingang gefunden hat und dass die Folgen des Datenschutzes „untergewichtet“ würden (S. 250).
Aus den knappen „Schlussbemerkungen“ (VII.) sei nur ein kurzes Zitat gebracht: „Statt Integrationsdünkel ist Demut angezeigt“ (S. 263). Dies kann nur unterstrichen werden – wie überhaupt in vielem, was heute geregelt wird, Perfektionismus der falsche Weg ist und Demut gerade vor den zu erwartenden Herausforderungen der nächsten Jahre als die richtige Denkungsart erscheint.
Der Band ist eine sehr sorgfältige Quellenarbeit, was sich nicht zuletzt darin äußert, dass viele Seiten fast nur aus Fußnoten bestehen. Auffällige Ausnahme von der Gründlichkeit dieser Arbeit: Silvio Berlusconi, der natürlich auch im Buch vorkommt, war nie italienischer Staatspräsident – was auch einem Lektorat hätte auffallen müssen (S. 41).
Entsprechendes gilt für den Gliederungsfehler bei IV. 2. b), der sowohl im Inhaltsverzeichnis wie im Text enthalten ist.
Fazit: Lesenswert und hoffentlich mit der Folge entsprechender Sensibilisierung. Denn wer mit offenen Augen seine Welt durchschreitet, wird sehen, dass die Zustände in unserem Land buchstäblich überall hinterfragbar sind – wobei mehr falsche Regelungen oftmals nur mehr Bemühungen evozieren, mit korruptem Verhalten diese zu umgehen.
Gertrude Lübbe-Wolff
Der ehrliche Deutsche. Über Problemverleugnung, Moralismus und Regelungsillusion in Sachen Korruption
Vittorio Klostermann, 1. Aufl. 2025
344 Seiten; 29,80 Euro
ISBN: 978-3-465-04668-4