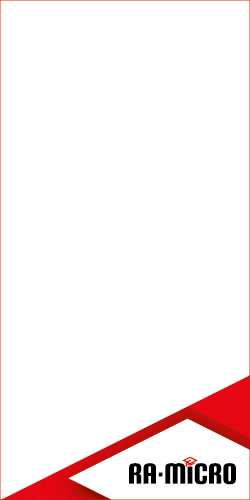Härtings Internetrecht – ein fast unglaublicher Klassiker
Die achte Auflage erscheint nach nur zwei Jahren
Matthias Wiemers
 Der Berliner Anwalt Professor Niko Härting (gebürtig ist er Westfale), hat es tatsächlich geschafft, seit 1999 ein Lehrbuch zum „Internetrecht“ in acht Auflagen herauszubringen, an dessen verändertem Volumen sich die Entwicklung dieses Rechtsgebiets ablesen lässt. Vor mir liegen die fünfte (von 2014) und die aktuelle achte Auflage (die erste müsste noch irgendwo stecken, derzeit unauffindbar). Betrug der Umfang der Erstauflage laut Internet 210 Seiten, so ist das Werk inzwischen auf 624 Seiten angewachsen, war aber auch schon umfangreicher, so in der fünften Auflage gar 882 Seiten stark. Woran liegt dies? Interessanterweise gibt uns der Autor hierzu im Vorwort der Neuerscheinung einige Hinweise. So sei der Rotstift sein treuer Begleiter bei jeder Aktualisierung. Richtig ist aber sicher auch der Hinweis, dass das Vorhandensein von Rechtsprechung „ein verlässlicher Indikator für das Vorhandensein von Unsicherheit“ sei. Auch wenn man dieser Aussage sicherlich das Wort „höchstrichterliche“ einfügen muss, so ist die Aussage zu unterstreichen. Und die aktuelle Auflage enthält nunmehr keinen Anhang „Rechtsprechungsübersicht“, der in der fünften Auflage etwa 80 Seiten umfasste. Auch hat Härting den just in der fünften Auflage eingefügten „Annex Datenschutz im 21. Jahrhundert“ inzwischen gestrichen, der etwas prophetisch war und jedenfalls durch einige inzwischen erfolgte Kodifizierungen nicht mehr ganz aktuell.
Der Berliner Anwalt Professor Niko Härting (gebürtig ist er Westfale), hat es tatsächlich geschafft, seit 1999 ein Lehrbuch zum „Internetrecht“ in acht Auflagen herauszubringen, an dessen verändertem Volumen sich die Entwicklung dieses Rechtsgebiets ablesen lässt. Vor mir liegen die fünfte (von 2014) und die aktuelle achte Auflage (die erste müsste noch irgendwo stecken, derzeit unauffindbar). Betrug der Umfang der Erstauflage laut Internet 210 Seiten, so ist das Werk inzwischen auf 624 Seiten angewachsen, war aber auch schon umfangreicher, so in der fünften Auflage gar 882 Seiten stark. Woran liegt dies? Interessanterweise gibt uns der Autor hierzu im Vorwort der Neuerscheinung einige Hinweise. So sei der Rotstift sein treuer Begleiter bei jeder Aktualisierung. Richtig ist aber sicher auch der Hinweis, dass das Vorhandensein von Rechtsprechung „ein verlässlicher Indikator für das Vorhandensein von Unsicherheit“ sei. Auch wenn man dieser Aussage sicherlich das Wort „höchstrichterliche“ einfügen muss, so ist die Aussage zu unterstreichen. Und die aktuelle Auflage enthält nunmehr keinen Anhang „Rechtsprechungsübersicht“, der in der fünften Auflage etwa 80 Seiten umfasste. Auch hat Härting den just in der fünften Auflage eingefügten „Annex Datenschutz im 21. Jahrhundert“ inzwischen gestrichen, der etwas prophetisch war und jedenfalls durch einige inzwischen erfolgte Kodifizierungen nicht mehr ganz aktuell.
Der Band beginnt mit einem Kapitel über das „Datenschutzrecht“ (A.), das früher einmal erst an zweiter Stelle, nach dem Kapitel über „Persönlichkeitsrechte“, kam, mit dem es inzwischen vertauscht ist. Das Kapitel stellt keine abstrakten Rechtsausführungen dar, sondern ist gegliedert nach konkreten Anspruchsgrundlagen, beginnend mit denen über Auskünfte und Schadensersatz, weil sich diese bereits als besonders häufig erhoben herausgestellt hätten. In weiteren Abschnitten werden weitere Ansprüche präsentiert, wobei immer wieder auch auf eine frühere Rechtslage eingegangen wird, so dass insgesamt die Neuerungen durch die DSGVO besonders deutlich hervortreten.
Im zweiten Kapitel über „Persönlichkeitsrechte“ (B.) werden eingangs in aller Kürze die Probleme der Kommunikation im Netzt beschrieben und sodann ausführlicher auf Besonderheiten der Online-Publikation hingewiesen, anhand der Sphärentheorie wird ausführlich aufgezeigt, welche Rechte diesen Sphären zuzuordnen sind. Besondere Abschnitte erhalten Bewertungsportale, Online-Archive sowie das Recht am eigenen Bild. Das Kapitel zum „Vertragsrecht“ (C.) präsentiert praktisch die Rechtsgeschäftslehre durch die Brille der elektronischen Kommunikation betrachtet. Einschließlich des AGB Rechts.
Um den Inhalt von Verträgen geht es im Folgekapitel, wo die Probleme von Verträgen geschildert werden, die Internetdienstleistungen zum Gegenstand haben. Im einzelnen werden behandelt:
• Webdesignverträge
• Providerverträge,
• Domainverträge,
• Cloud-Computing,
• Werbeverträge sowie
• Plattformverträge nebens Nutzungsbedingungen.
Kapitel E bringt eine aktuelle Darstellung des Fernabsatzrechts, bevor es dann in einige Spezialgebiete geht: „Urheberrecht“ (F.), „Wettbewerbsrecht“ (G.) und „Domainrecht“ (H.).
Abschließend finden wir zwei Kapitel, die sich aus der Natur des Netzes ergeben, das besondere Lösungen zunächst im Haftungsrecht erfordert. Die „Haftung im Netz“ (J.) beinhaltet zwar zunächst auch Haftungsprivilegien, wie sie inzwischen im Digital Service Act der EU niedergelegt und deshalb auch von Härting geschildert wurden. Sodann werden die möglichen tatsächlichen Grundlagen für eine Haftung im Netz durchgemustert – von digitalen Diensten bis hin zum Caching, ergänzt um mögliche Ansprüche nach dem Urheberrechts-Diensteanbietergesetz. Die in früheren Jahren noch mehr Betreiber von WLAN gelegentlich überraschende so genannte Störerhaftung bildet gewissermaßen die zweite Hälfte der Darstellung in diesem Kapitel. Das letzte Kapitel setze sich mit „Kollisionsrecht“ (K.) auseinander, weil es ja ohne weiteres nachzuvollziehen ist, dass es Rechtswahlvereinbarungen gibt, insbesondere in Klauselform, die nach dazu auf entsprechende Klauseln des Vertragspartners treffen können, die aber inhaltlich nicht übereinstimmen. Behandelt werden aber auch das außervertragliche Haftungsrecht und die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte.
Das einst als „Büchlein“ apostrophierte Werk ist inzwischen zu einem Monument praxisorientierter Ausformulierung eines eigenständigen Rechtsgebiets geworden. Denn zu recht betont der Autor selbst in seinem Vorwort, das Internetrecht habe sich (seit der Erstauflage) vom Softwarerecht emanzipiert. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Härtling
Internetrecht
Verlag Dr. Otto Schmidt, 8. Auflage 2025
642 Seiten; 98,00 Euro
ISBN 978-3-504-56098-0